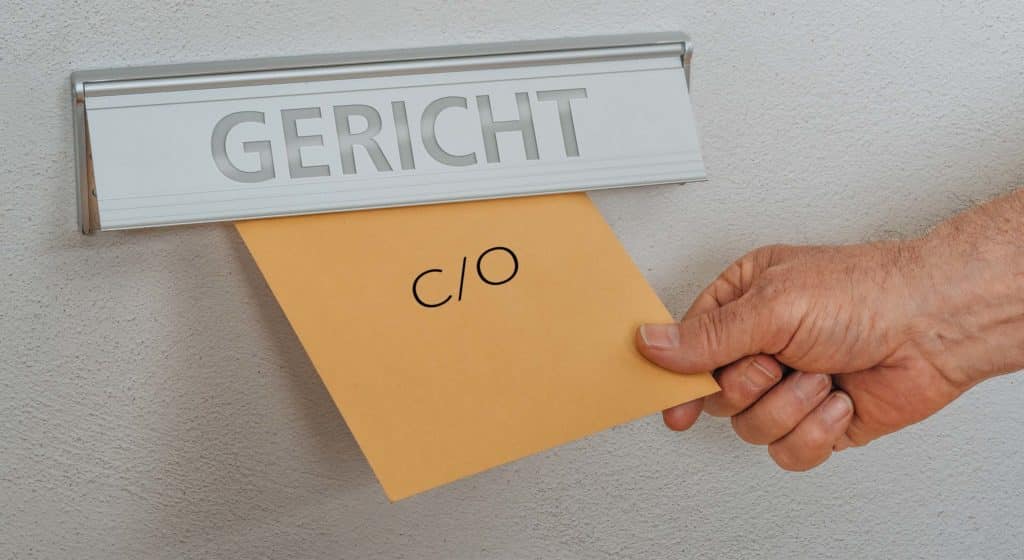Wer eine Stiftung gründen möchte, sollte die wesentlichen Grundlagen des deutschen Stiftungsrechts kennen und verstehen. Es regelt sämtliche rechtlichen Rahmenbedingungen, die für die Errichtung, Verwaltung und Kontrolle von Stiftungen gelten – egal ob für gemeinnützige, privatnützige oder unternehmensbezogene Zwecke.
Dieser Beitrag bietet Ihnen einen fundierten Überblick über die wichtigsten Aspekte des Stiftungsrechts und zeigt auf, worauf Sie bei Gründung und Führung Ihrer Stiftung besonders achten sollten.
Was ist das Stiftungsrecht?
Das Stiftungsrecht umfasst alle gesetzlichen Vorschriften und Normen, die bei Errichtung, Betrieb und Kontrolle von Stiftungen relevant sind. Es ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), speziell in den §§ 80 bis 88, geregelt und wird ergänzt durch Landesstiftungsgesetze sowie steuerrechtliche Vorschriften. Die aktuelle Stiftungsrechtsreform verfolgt dabei das Ziel, das Recht bundesweit stärker zu harmonisieren und mehr Rechtssicherheit für Stifter zu schaffen.
Die wichtigsten Grundlagen des Stiftungsrechts
1. Rechtsfähige Stiftung (Standardform)
Die rechtsfähige Stiftung stellt die häufigste Stiftungsform dar. Sie ist ein eigenständiges Rechtssubjekt, das erst durch Anerkennung der zuständigen Stiftungsbehörde entsteht (§ 80 BGB).
Wesentliche Voraussetzungen:
Dauerhaft festgelegter Zweck (gemeinnützig oder privatnützig)
Ausreichendes Stiftungsvermögen
Satzung mit klar definierten Regelungen zu Zweck, Vermögensbindung und Stiftungsorganen
Ein ausreichendes Stiftungsvermögen.
Formale Errichtung durch Stiftungsgeschäft (notarielle Erklärung oder Testament)
2. Treuhandstiftung
Treuhandstiftungen sind nicht rechtsfähig. Sie werden treuhänderisch verwaltet und unterliegen keiner staatlichen Aufsicht, bieten dafür aber mehr Flexibilität, insbesondere bei geringerem Kapitalbedarf. Sie eignen sich besonders, wenn das Startkapital begrenzt ist oder mehr Flexibilität erwünscht wird.
Überblick über wichtige Stiftungsformen
Die Wahl der geeigneten Stiftungsform richtet sich nach dem angestrebten Zweck, der Kapitalausstattung und dem geplanten zeitlichen Engagement:
Gemeinnützige Stiftung: Verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke (z. B. Bildung, Wissenschaft, Umweltschutz, Kultur) und genießt umfassende steuerliche Begünstigungen.
Familienstiftung: Dient der langfristigen Sicherung des Familienvermögens und der Versorgung von Familienmitgliedern. Sie unterliegt alle 30 Jahre einer Erbersatzsteuer (vergleichbar der Erbschaftsteuer), erhält jedoch keine Steuervergünstigungen wie gemeinnützige Stiftungen.
Unternehmensstiftung: Hält Unternehmensanteile, sichert die Unternehmensnachfolge und kann sowohl gemeinnützige als auch privatnützige Elemente kombinieren.
Treuhandstiftung: Bietet Flexibilität und geringere Verwaltungskosten. Sie eignet sich besonders für kleinere oder temporäre Projekte.
Verbrauchsstiftung: Das Vermögen wird innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums vollständig verbraucht – ideal für zeitlich begrenzte Projekte oder einmalige Vorhaben.
Jede Stiftungsform sollte individuell nach dem Stifterwillen, den verfügbaren Mitteln und dem geplanten Wirkungszeitraum ausgewählt werden.
Rechtliche Vorgaben zur Satzung und den Stiftungsorganen
Eine Satzung muss laut BGB (§§ 80 ff.) zwingend folgende Elemente beinhalten:
Präzise Formulierung des Stiftungszwecks
Vermögensausstattung und Verwendung der Erträge
Festlegung der Stiftungsorgane (z. B. Vorstand, optional Stiftungsrat)
Anpassungsregelungen, um den Stifterwillen langfristig zu wahren
Stiftungsorgane wie Vorstände müssen Entscheidungen gemäß der sogenannten Business Judgement Rule treffen: Sie müssen ihre Entscheidungen sorgfältig, unter Abwägung angemessener Informationen und ausschließlich im Sinne des Stiftungszwecks treffen.
Ablauf der Stiftungsgründung
Die Gründung einer rechtsfähigen Stiftung erfolgt in klar definierten Schritten, die im BGB und den jeweiligen Landesgesetzen geregelt sind:
Die einzelnen Schritte im Überblick:
Festlegung des Stiftungszwecks: Dieser muss dauerhaft verfolgt werden und rechtlich zulässig sein.
Erstellung der Satzung: Enthält alle relevanten Regelungen zu Zweck, Vermögen und Organen.
Formales Stiftungsgeschäft: Notariell beglaubigte Erklärung oder letztwillige Verfügung (Testament).
Kontakt zur Stiftungsbehörde: Frühzeitige Beratung mit der Behörde verbessert die Chancen auf Anerkennung und klärt wichtige Fragen zu Zweck und Kapitalausstattung.
Nachweis des Stiftungsvermögens
Es muss belegt werden, dass das Stiftungsvermögen zur dauerhaften Zweckverwirklichung ausreicht. Dies erfolgt durch Kontoauszüge oder verbindliche Kapitalzusagen.Einreichung der Unterlagen
Die vollständigen Unterlagen (Satzung, Stiftungsgeschäft, Nachweise zur Vermögensausstattung) werden bei der zuständigen Behörde eingereicht. Diese prüft, ob die rechtlichen Anforderungen erfüllt sind.Anerkennung und Eintragung
Nach positiver Prüfung wird die Stiftung durch behördlichen Bescheid als rechtsfähig anerkannt. Ab 2026 erfolgt zusätzlich die Aufnahme in das bundesweite Stiftungsregister.
Die Stiftungsrechtsreform: Was hat sich geändert?
Die umfassende Stiftungsrechtsreform bringt wichtige Neuerungen:
Einrichtung eines zentralen, öffentlich einsehbaren Stiftungsregisters
Präzisere Regelungen zu Vermögensbindung, Zweck- und Satzungsänderungen
Verbesserte Rechtssicherheit bei Anpassungen der Satzung
Ziel ist, Transparenz und Vertrauen in das deutsche Stiftungswesen weiter zu stärken.
Zuständigkeiten der Stiftungsaufsicht
Die Stiftungsaufsicht überwacht die Einhaltung der Satzung, des Stifterwillens und des Stiftungsrechts. Sie verhindert zudem eine zweckwidrige Mittelverwendung.
Steuerrechtliche Rahmenbedingungen
Das Stiftungsrecht ist eng mit dem Steuerrecht verbunden:
Gemeinnützige Stiftungen sind in der Regel von der Erbschaftsteuer, Schenkungssteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit.
Zustiftungen und Spenden sind nach § 10b EStG abzugsfähig.
Die Einhaltung der Gemeinnützigkeit wird regelmäßig durch das Finanzamt geprüft.
Fazit
Das Stiftungsrecht bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, um individuelle, gemeinnützige oder unternehmensbezogene Ziele langfristig und rechtssicher zu verfolgen. Die Wahl der passenden Stiftungsform, die sorgfältige Ausarbeitung der Satzung sowie die strukturierte Gründung sind entscheidend für den nachhaltigen Erfolg einer Stiftung. Durch die anstehende Stiftungsrechtsreform ab 2026 wird das deutsche Stiftungswesen zudem noch transparenter und einheitlicher geregelt – ein bedeutender Schritt hin zu mehr Rechtssicherheit und Vertrauen. Wer eine Stiftung errichten möchte, sollte sich daher frühzeitig mit den rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen vertraut machen und gegebenenfalls fachkundige Beratung in Anspruch nehmen.
Häufige Fragen zum Stiftungsrecht (FAQ)
Welche Rolle spielt der Bundesverbandes Deutscher Stiftungen?
Der Bundesverband vertritt die Interessen von Stiftungen in Deutschland und wirkt aktiv an der Weiterentwicklung des Stiftungsrechts mit, u.a. durch Stellungnahmen zu Gesetzesreformen und Empfehlungen zur Stiftungsarbeit.
Was ist das Stiftungsregister und warum ist es wichtig?
Das Stiftungsregister wird ab 2026 bundesweit eingeführt und schafft Transparenz über bestehende Stiftungen. Es macht zentrale Informationen wie Name, Sitz, Stiftungszweck und Organe öffentlich zugänglich.
Wie unterscheiden sich die Regelungen der Bundesländer?
Zwar gilt das Bundesrecht, aber bisher haben einzelne Bundesländer noch unterschiedliche Landesstiftungsgesetze. Ziel der Reform ist es, diese Unterschiede zu verringern und die Vorgaben bundesweit zu vereinheitlichen.
Dürfen Rechtsanwälte Teil des Stiftungsvorstands sein?
Ja, Rechtsanwälte können als externe Experten Teil der Stiftungsorgane sein, um rechtliche Fragen der Stiftungsarbeit zu begleiten und die Satzung korrekt umzusetzen.
Was gilt es beim Einsatz des Stiftungsvermögens zu beachten?
Das Stiftungsvermögen muss gemäß Satzung und geltendem Stiftungsrecht nachhaltig verwaltet und ausschließlich zur Verwirklichung des definierten Zwecks eingesetzt werden.
Welche Vorschriften gelten bei der Zweckänderung?

Jetzt Beratung anfragen: kontakt@ratgeber-stiftung.de